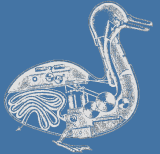 | Vom
mechanistischen zum organischen Denken |

|
| bio-logos.de | Werner Merker |
|
|
Methodik zur Erforschung des Lebendigen (Auszug aus dem Buch "Die Wissenschaft des Lebendigen") Der folgende Artikel vertieft die im Artikel2001
bereits dargestellte künstlerisch-naturwissenschaftliche Methodik
Goethes. Goethes Epoche Goethes Lebensspanne fiel in eine sehr bewegte Epoche. Große soziale, politische und technische Veränderungen fanden zu seiner Zeit statt. Die Französische Revolution und die anschließenden napoleonischen Kriege erschütterten Europa und veränderten die etablierten gesellschaftlichen Strukturen. Auch die beginnende industrielle Revolution ließ bereits gravierende Veränderungen im Leben der Menschen erahnen. Auf dem Boden der Aufklärung konnte sich die aufblühende Naturwissenschaft stürmisch entwickeln. Viele Menschen machten sich im eigenen Labor oder in der Welt draußen zu großen Forschungsreisen auf. Naturkundliche Beobachtungen, Erfahrungen, und Erkenntnisse wurden in immer größerer Zahl gesammelt und in allen Bereichen des Forschens war man bemüht diese zu ordnen und zu systematisieren. Im technischen Bereich wurde die Dampfmaschine gebaut, die fließende Elektrizität entdeckt, das Dualzahlensystem entwickelt und es wurden die ersten Rechenmaschinen konstruiert. In dieser turbulenten Aufbruchszeit verfasste Goethe seine teilweise erstaunlich zeitlos anmutenden und sich mehr dem allgemein Menschlichen zuwendenden literarischen Werke. Für einen Künstler und Dichter, der er durch und durch war, ist weiterhin überraschend, dass er seine psychologische Einfühlungstiefe, sein ästhetisches Wahrnehmungsvermögen und seine ihm von einem Jugendfreund attestierte »außerordentliche Einbildungskraft«1 auch zum naturwissenschaftlichen Forschen nutze. Dass er dabei eine völlig unkonventionelle, künstlerische wissenschaftliche Methodik entwickelte, ist nicht weiter verwunderlich. In viele der zur damaligen Zeit noch nicht so stark getrennten Gebiete der Naturforschung brachte er sich forschend ein, war aktives Mitglied zahlreicher naturwissenschaftlicher Gesellschaften, korrespondierte mit führenden Wissenschaftlern und veröffentlichte auf den Gebieten der Botanik, Zoologie, Geologie, Meteorologie und Farbenlehre. Am Ende seines Lebens betrachtete er sogar seine wissenschaftlichen Leistungen teilweise als bedeutender als sein literarisches Werk: »Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir gar nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir, und es werden ihrer nach mir sein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute, und ich habe daher ein Bewusstsein der Superiorität über viele.«2 Wenn auch Goethe hier seine Farbenlehre in den Vordergrund stellt, so ist sein wichtigstes naturwissenschaftliches Vermächtnis an die Nachwelt doch eher seine völlig neu entwickelte wissenschaftliche Methodik, die besonders im Bereich der belebten Natur die wichtigsten Impulse für eine dem Lebendigen angemessene organische Betrachtungsweise geliefert hat. Dies wird auch durch eine Äußerung bezeugt, mit der Goethe zwei Jahre vor seinem Tod auf einen Wissenschaftsstreit zwischen zwei französischen Naturforschern reagierte. Dabei ging es um eine Auseinandersetzung zwischen der analytischen und synthetischen Sichtweise der belebten Natur. Goethe triumphierte: »Das beste aber ist, dass die von Geoffroy in Frankreich eingeführte synthetische Behandlungsweise der Natur jetzt nicht mehr rückgängig zu machen ist. […] Dieses Ereignis ist für mich von ganz unglaublichem Wert, und ich jubele mit Recht über den endlich erlebten, allgemeinen Sieg einer Sache, der ich mein Leben gewidmet habe.«3 Tatsächlich war diese Interpretation des französischen Akademiestreits wohl zu euphorisch und es war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken, aber es zeigt doch, wie sehr Goethe eine dem Lebendigen angemessene Naturbetrachtung als seine Lebensaufgabe ansah. Urvater organischen Denkens Was ist das Besondere an Goethes naturwissenschaftlicher Methode und wieso kann Goethe als Urvater des organischen Denkens betrachtet werden? Goethe genoss in seiner Kindheit und Jugend eine umfassende Privaterziehung, welche neben einer intensiven sprachlichen Ausbildung, – er erlernte sieben Sprachen –, auch eine Ausbildung in Zeichnen und Malen beinhaltete. Durch seinen kunstinteressierten Vater herrschte in seinem Elternhaus ein künstlerisches Element, besonders in Form von Diskussionen zur Kunstbetrachtung, an welchen Goethe sich nicht scheute auch schon als Knabe teilzunehmen. So konnte er schon früh seinen künstlerischen Blick schulen. Naturkundlichen Unterricht erhielt er kaum, entwickelte aber auf diesem Gebiet, angeregt durch seinen Großvater, ein großes Interesse, welches ihn auch zu der Zeit schon zu eigenen Forschungen führte. Diese drei für ihn wichtigen Bereiche Sprache, Kunst und Naturwissenschaft wurden also in seiner Jugend schon angelegt, prägten sein Leben und sollten von ihm zu einer gegenseitigen Befruchtung geführt werden. In allen drei Bereichen ging es ihm darum Wesen und Erscheinung zusammenzuführen, in der Literatur das Wesen seiner Figuren zur Erscheinung zu bringen, in der Naturwissenschaft aus den Erscheinungen auf das Wesen zu schließen und in der Kunst beide Vorgehensweisen zu üben und zu verbinden. Das Wesen ist immer ein Ganzes. Goethes Sichtweise ist daher immer eine ganzheitliche. Das analytische Zergliedern und Zerstückeln, welches sich schon zu seiner Zeit als Wissenschaftsmethodik immer stärker durchsetzte, liegt ihm fern, besonders im Bereich des Lebendigen. In seinen letzten Jahren kann er durchaus anerkennen, dass beide zusammen, sowohl die analytische als auch die ganzheitliche Betrachtungsweise, sich zum vollständigsten naturwissenschaftlichen Erkennen ergänzen. Seine Lebensaufgabe sieht er aber darin, der ganzheitlichen Sicht zur Geltung zu verhelfen. Wissenschaftlich drückt er dies in seiner Schrift zur Morphologie folgendermaßen aus: »Aber diese trennenden Bemühungen, immer und immer fortgesetzt, bringen auch manchen Nachteil hervor: Das Lebendige ist zwar in Elemente zerlegt, aber man kann es aus diesen nicht wieder zusammenstellen und beleben. Dieses gilt schon von vielen anorganischen, geschweige von organischen Körpern.«4 Im Faust wird die ungeheure Begrenztheit einer analytischen Naturwissenschaften in bezug auf das Lebendige durch die Gestalt des Mephisto spöttisch dargestellt: "Wer will etwas Lebendiges erkennen und beschreiben, Physiologische Studien Noch in seiner Frankfurter Zeit wurde Goethe durch den Züricher Philosophen und Theologen Johann Kaspar Lavater zu ersten Wahrnehmungsübungen zum Zusammenklingen von Wesen und Erscheinung angeregt. Lavater ging davon aus, dass sich das Seelische des Menschen in der Gestalt und besonders im Haupt und im Antlitz ausdrückt. Diese Physiognomik Lavaters fand viel Anerkennung und es war in feinen gesellschaftlichen Kreisen regelrecht Mode Portraits von bekannten Persönlichkeiten, meist als Schattenrisse, auszutauschen und anhand der Physiognomie auf den Charakter der betreffenden Person zu schließen. Lavater stand in Kontakt mit Pieter Camper, einem holländischen Professor für Medizin und Botanik, der sich auch mit physiognomischen Studien beschäftigte, wobei er mehr davon ausging, dass wiederholte Emotionen als Gewohnheiten Spuren in den Gesichtszügen eines Menschen hinterlassen. Campers Forschungen gingen aber weit über die Physiognomie hinaus. Er war künstlerisch begabt und als talentierter Zeichner auch Dozent an der Amsterdamer Zeichenakademie. Von ihm sind zahlreiche anatomische Zeichnungen und Lehrtafeln erhalten, die auch Goethe bekannt waren. Mit seiner künstlerisch-wissenschaftlichen Methodik wurde er Goethe zum Vorbild. 1830 schilderte Goethe rückblickend, wie schmerzlich es für ihn war, dass dieser von ihm so bewunderte Camper seine Entdeckung des Zwischenkieferknochens nicht anerkannte: »Ich kann nicht ausdrücken, welche schmerzliche Empfindung es mir war, mit demjenigen in entschiedenem Gegensatz zu stehen, dem ich so viel schuldig geworden, dem ich mich zu nähern, mich als seinen Schüler zu bekennen, von dem ich alles zu lernen hoffte.«5 Auf Campers wissenschaftliche Methodik wird noch genauer einzugehen sein. Blumenbachs Bildungstrieb 1775 gab Goethe seine Anwaltskanzlei in Frankfurt auf, wechselte in den Dienst des Herzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach und ließ sich dauerhaft in Weimar nieder. Hier fand er ein wissenschaftlich außerordentlich anregendes Umfeld mit interessanten Forscherpersönlichkeiten vor, mit denen er, inzwischen berühmt, leicht Kontakt aufnehmen konnte. Eine dieser Persönlichkeiten war der Göttinger Zoologe und Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach, mit dem Goethe über 50 Jahre in Austausch blieb. Blumenbach hatte mit seinen vitalistischen Ansichten erheblichen Einfluss auf Kant und führte diesen zu der Forderung eines bildenden Prinzips im Lebendigen. Blumenbach war sich sicher, dass in einem lebendigen Körper »ein besonderer, dann lebenslang tätiger Trieb rege wird, ihre bestimmte Gestalt anfangs anzunehmen, dann lebenslang zu erhalten, und wenn sie ja etwas verstümmelt worden, wo möglich wieder herzustellen. Ein Trieb, […] der die erste wichtigste Kraft zu aller Zeugung, Ernährung, und Reproduktion zu sein scheint und den man, um ihn von anderen Lebenskräften zu unterscheiden, mit dem Namen des Bildungstriebes (nisus formativus) bezeichnen kann.«6 Kant kam nach ausführlichen philosophischen Überlegungen zu der Überzeugung, dass ein solcher Bildungstrieb zu fordern ist, hielt ihn aber für ein »uns unerforschliches Prinzip«.7 Goethe sind Blumenbachs Vorstellungen und Kants philosophische Überlegungen vertraut. Er schenkt ihnen aber zunächst nur wenig Beachtung, da sein Ansatz viel lebenspraktischer und empirischer ist: »Das Höchste wäre zu begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist. […] Man suche nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre.«8 Ein formendes Prinzip oder ein Bildungstrieb im lebendigen Organismus interessieren ihn nicht als logisch zu postulierende Hypothese. Für ihn ist das eine wahrnehmbare Realität. Sein Ausgangspunkt ist stets seine eigene Wahrnehmung und sein eigenes ästhetisches Erleben dieser Wahrnehmung, wodurch in der Anschauung eine Verbindung von Wesen und Erscheinung entsteht. Erst 1820 veröffentlicht er nach erneutem Durcharbeiten von Blumenbachs Werk einen Aufsatz zum Bildungstrieb: »Nun gewann Blumenbach das Höchste und Letzte des Ausdrucks, er anthropomorphosierte das Wort des Rätsels und nannte das, wovon die Rede war einen nisus formativus, einen Trieb, eine heftige Tätigkeit, wodurch die Bildung bewirkt werden sollte.«9 Goethe ist völlig klar, dass etwas lebendig Vorhandenes nicht ohne eine vorherige Tätigkeit entstanden sein kann, und er formuliert daher weiter: » Betrachten wir das alles genauer, so hätten wir es kürzer, bequemer und vielleicht gründlicher, wenn wir eingestünden, dass wir, um das Vorhandene zu betrachten, eine vorhergegangene Tätigkeit zugeben müssen.« Dieses lebendig in seinem Element Tätige könnte man nach Goethe in personifizierender Weise auch als Schöpfergott bezeichnen. Jedenfalls, so führt er weiter aus, muss dem Geschaffenen immer etwas Schaffendes vorausgehen. Am Ende seines kurzen Aufsatzes verbindet er den Begriff des Bildungstriebes mit der von ihm schon 30 Jahre zuvor entdeckten Metamorphose bei Pflanzen und Tieren: »So viel aber getraue ich mir zu behaupten, dass, wenn ein organisches Wesen in die Erscheinung hervortritt, Einheit und Freiheit des Bildungstriebes ohne den Begriff der Metamorphose nicht zu fassen sei.«10. Einen Bildungstrieb stellt er also nicht in Frage, wenn auch eine gewisse Skepsis diesem Begriff gegenüber deutlich wird. Dieser scheint ihm nur über die von ihm entwickelte Morphologie, die Lehre von der Gestalt und der Umbildung der Gestalt, zugänglich zu sein. Im letzten Satz dieses Aufsatzes spricht er von der »Einheit und Freiheit des Bildungstriebes«. Unter Einheit versteht er die in seiner Morphologie entwickelten Begriffe Urpflanze, Urtier oder Typus und unter Freiheit die Veränderlichkeit des Typus, was im Folgenden genauer ausgeführt werden soll. Künstlerische Einfühlung - Goethes verborgenes Prinzip An der Morphologie und der Metamorphoselehre hat Goethe Zeit seines Lebens gearbeitet. Dabei bestand die Schwierigkeit vor allem darin, seine Anschauungen und Wahrnehmungen von Pflanzen und Tieren begrifflich darzustellen. Ohne sich seiner besonderen, im Grunde eigentlich völlig normalen, Art der Wahrnehmung des Lebendigen anzunähern, ist seine Morphologie kaum zu verstehen. Was ist nun das Besondere der Goetheschen Wahrnehmung? In der rückblickenden Beschreibung seines naturwissenschaftlichen Entwicklungsganges schrieb Goethe 1821 über sich: »Kein eigentlich scharfes Gesicht. Daher die Gabe, die Gegenstände anmutig zu sehen. […] Großer Vorteil des sukzessiven Erkennens.«11 Seine genauen Naturbeobachtungen und -beschreibungen zeigen, wie wichtig bei ihm der Sehsinn war. Dennoch war sein Sehvermögen auf einem Auge nicht besonders gut und er hätte eigentlich eine Brille tragen müssen, wogegen er sich allerdings vehement sträubte. Aber er besaß die Gabe die Gegenstände »anmutig« zu sehen, das heißt, seine Wahrnehmung eines Gegenstandes war stets von künstlerischer Einfühlung und einer ästhetischen Empfindung begleitet. Besonders während seiner zweijährigen Italienreise (1786–1788) schulte Goethe diese Gabe durch häufige Kunstbetrachtung und intensives Zeichnen und Malen unter Anleitung befreundeter Künstler. In dieser Zeit rang er mit der Frage, ob er nicht Maler werden solle. Seine besondere Gabe der Wahrnehmung wurde ihm zu dieser Zeit verstärkt bewusst: »Mein Prinzip, die Kunstwerke zu erklären und das auf einmal aufzuschließen, woran Künstler und Kenner sich schon seit der Wiederherstellung der Kunst zersuchen und zerstudieren, find' ich bei jeder Anwendung richtiger. Eigentlich ist's auch ein Kolumbisches Ei. Ohne zu sagen, dass ich einen solchen Kapitalschlüssel besitze, sprech' ich nun die Teile zweckmäßig mit den Künstlern durch und sehe, wie weit sie gekommen sind.«12 Einige Tage zuvor hatte er sich in einem Brief bereits ähnlich geäußert: »Meine Kunststudien gehen sehr vorwärts, mein Prinzip passt überall und schließt mir alles auf. Alles, was Künstler nur einzeln mühsam zusammensuchen müssen, liegt nun zusammen offen und frei vor mir.«13 Besonders geheimnisvoll sind seine allegorischen Bemerkungen zu seinem verborgenen Prinzip einen Monat später: In einem Brief an seine Weimarer Freunde kritisiert er zunächst den zusammengesetzten, künstlichen und mechanistischen Charakter abgehobener Hypothesen und Prinzipien, welche nicht an die eigentlichen Inhalte herankommen und nicht die »Tiefe der Natur« näher aufschließen können, und beschreibt dann seine eigene, das Flüssige fördernde archimedische Schraube: »Wenn es also irgendwo fehlt, so mangelt's nicht an der Ware, sondern an Käufern, nicht an der Maschine, sondern an denen, die sie zu brauchen wissen. Ich habe immer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn sie mich in metaphysischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler bin, so kann mir's gleich sein. Mir könnte vielmehr dran gelegen sein, dass das Prinzipium verborgen bliebe, aus dem und durch das ich arbeite. Ich lasse einem jeden seinen Hebel und bediene mich der Schraube ohne Ende schon lange, und nun mit noch mehr Freude und Bequemlichkeit.«14 Dieses verborgene Prinzip ästhetischer Anschauung und künstlerischer Einfühlung wendet Goethe während seines Italienaufenthalts auch auf die Pflanzenbetrachtung an und entwickelt damit seine Metamorphoselehre. An seinen Freund Johann Gottfried Herder schreibt er 1787 aus Italien: »Ferner muss ich Dir vertrauen, dass ich dem Geheimnis der Pflanzenerzeugung und -organisation ganz nahe bin und dass es das Einfachste ist, was gedacht werden kann.«15 Aus einer ästhetischen Pflanzenbetrachtung, wie er sie später einmal genannt hat, entwickelt er zunehmend eine wissenschaftliche Erkenntnismethode. Das »Einfachste« oder wie vorher benannt das »Kolumbische Ei«, ist die Methode daher, weil sie rein auf lebenspraktischem Anschauen und Erfahren und nicht auf kompliziertem diskursiven Denken beruht. Auch sind keine analytisch zerstückelnde Untersuchungen oder entsprechende Laborgerätschaften erforderlich. Schwierig ist dieses Erfahren und Erkennen allerdings dadurch, dass ein teilnahmsloses Anschauen der äußeren Gestalt, was eine nach Objektivität strebende Wissenschaft ja als Ideal ansieht, nicht ausreicht. In seinem Roman »Wilhelm Meisters Wanderjahre« schreibt Goethe: »Gewöhnliches Anschauen, richtige Ansicht der irdischen Dinge ist ein Erbteil des allgemeinen Menschenverstandes; reines Anschauen des Äußern und Innern ist sehr selten.«16 Es ist wohl ein großes Verdienst Goethes, dass er zunächst empirisch, später auch philosophisch klar herausgearbeitet hat, dass auch beim wissenschaftlichen Wahrnehmen dem Äußeren immer ein Inneres, Subjektives entgegengebracht wird und beides korrespondiert und zusammenklingt. Schon vor seinem Durchbruch in der Morphologie schreibt er aus Italien: »Ich gehe nur immer herum und herum und sehe und übe mein Auge und meinen inneren Sinn […] Du weißt, was die Gegenwart der Dinge zu mir spricht, und ich bin den ganzen Tag in einem Gespräch mit den Dingen.«17 Viel später, 1823, beschreibt er als wesentliche Absicht seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen »auszusprechen, wie ich die Natur anschaue, zugleich aber gewissermaßen mich selbst, mein Inneres, meine Art zu sein, insofern es möglich wäre, zu offenbaren.«18 Lebendige Bildungen und innere Nachahmung In seiner Einleitung zur Morphologie beschreibt Goethe das Bestreben des Menschen, neben der analytisch kausalen Erkenntnis, den »trennenden Bemühungen«19, die nur im Materiellen möglich sind, auch das lebendige Bilden zu verstehen: »Es hat sich daher auch in dem wissenschaftlichen Menschen zu allen Zeiten ein Trieb hervorgetan, die lebendigen Bildungen als solche zu erkennen, ihre äußern sichtbaren, greiflichen Teile im Zusammenhange zu erfassen, sie als Andeutungen des Innern aufzunehmen und so das Ganze in der Anschauung gewissermaßen zu beherrschen. Wie nah dieses wissenschaftliche Verlangen mit dem Kunst- und Nachahmungstriebe zusammenhänge, braucht wohl nicht umständlich ausgeführt zu werden.«20 In der materialistischen Erforschung des anorganisch Unbelebten mag man sich auf die abgeschlossenen, und unveränderlich erscheinenden Gegenstände beschränken, die man scheinbar unabhängig von sich selbst als Beobachter betrachten kann. Doch auch hier korrespondiert das Innere mit dem Äußeren. Es wird zumindest ein innerer gedanklicher Begriff dem äußeren Wahrgenommenen entgegengebracht. Wendet man sich dem gestaltenden Lebendigen zu, so reicht ein fertiger, starrer Begriff nicht aus. Man muss sich auf das Bilden selbst und auf das Werden einlassen, muss in einen Prozess eintauchen und dies kann nicht durch einen toten Begriff geschehen. Man muss dem äußeren lebendigen Prozess einen inneren Prozess entgegenbringen. Man muss den äußeren Prozess innerlich mitmachen. Das nennt man Nachahmung. Das Erfassen des Lebendigen geschieht über die eigene Nachahmung und innerliches Nachschaffen.Es geht gar nicht anders. Einem Fließenden, sich stetig Wandelnden, Lebendigen kann man nicht starre Begriffe entgegenbringen. Es ist nur durch einen dynamischen nachahmenden Prozess zu erfahren, wie er auch in einem künstlerischen Schaffens- oder Betrachtungsprozess erforderlich ist. Damit dieser nachahmende Prozess auch zur Erkenntnis wird, muss das Bewusstsein diesen inneren, nachschaffenden Prozess beobachten und ins Gedankliche führen. Dabei ist eine große innere Beweglichkeit erforderlich: »Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschauen der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem sie uns vorgeht.«21 Diese Art des Vorgehens ist das, was Goethe an dem schon erwähnten Pieter Camper, »der den inneren Sinn des Beobachters aufzuschließen«22 vermag, so schätzte. 1830 schreibt er über Camper: »Petrus Camper, ein Mann von ganz eignem Beobachtungs- und Verknüpfungsgeiste, der mit dem aufmerksamen Beschauen zugleich eine glückliche Nachbildungsgabe verband und so, durch Reproduktion des Erfahrenen, dieses in sich selbst belebte und sein Nachdenken durch Selbsttätigkeit zu schärfen wusste.«23 Diese Art des Forschens, Wahrnehmens und Denkens wurde auch Goethe von dem Anthropologen J. C. A. Heinroth, einem Zeitgenossen, attestiert. Bewundernd muss dieser bei Goethe »ein hohes Denkvermögen anerkennen, welches aber freilich nicht auf die gewöhnliche, philosophische, abstrakte Weise, sondern auf ganz eigentümliche Weise, nämlich eben gegenständlich tätig ist.«24 Darunter versteht er, dass Goethes »Anschauen selbst ein Denken, sein Denken ein Anschauen ist; ein Verfahren, welches wir geradezu für das vollkommenste zu erklären genötigt sind.«25 Um so verfahren zu können sind Schulung und Gewöhnung notwendig, die Heinroth in Goethes Bemühungen erkennt: »Es setzt aber dieses Verfahren eine besondere Übung und Gewöhnung voraus, wie sie […] dieser plastische Genius sich von geraumer Zeit her gegeben hat.«26 Heinroth durchschaut Goethes Erkenntnisweise außerordentlich tiefsinnig. Er erkennt, dass Goethes künstlerische Schulung die Grundlage für sein naturwissenschaftliches Forschen gelegt hat. Er sieht »den Weg, von welchem das abstrakte Denken geradezu abführt, und auf welchen zunächst die Beschauung von Kunstwerken hinleitet, die nicht mit dem Auge allein, sondern zugleich mit dem Geiste gesehen sein wollen; eine Gewöhnung, welche zu gleicher Betrachtung der Naturerscheinungen einen leichten Übergang bahnt, dessen Folge und Gewinn ein gleichsam Hineinleben in das Leben der Natur ist.«27 Die Art und Weise des nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Geiste Sehens, die er dem »plastischen Genius« Goethe zuschreibt, erläutert er weiter: »[D]enn der Geist ist ja eben bildendes, gestaltendes Vermögen, und kann nur durch sein Formgeben zur Erkenntnis gelangen.«28 Die gestaltende, formbildende Kraft des Geistes sieht er also bei Goethe als Grundlage seiner Erkenntnis. Goethe, der insgesamt Heinroth eher kritisch gegenüber stand, konnte diese Einschätzung seiner Erkenntnisweise durchaus akzeptieren und bezeichnet sie als »geistreiches Wort«29, welches ihn bedeutend gefördert habe. Diese Art von Erkenntnisprozess durch ein Formgeben des Geistes könnte man auch als Imagination bezeichnen. Das ist natürlich ein Begriff, der bei einem mechanistisch-analytischen Naturwissenschaftler auf viel Skepsis stößt. Goethe bemerkt dazu nur lapidar: »Die Anschauenden verhalten sich schon produktiv, und das Wissen, indem es sich selbst steigert, fordert, ohne es zu bemerken, das Anschauen und geht dahin über, und so sehr sich auch die Wissenden vor der Imagination kreuzigen und segnen, so müssen sie doch, ehe sie sich versehen, die produktive Einbildungskraft zu Hilfe rufen.«30 Idee, Erkenntnis und Erfahrung Das Bleibende von der Wahrnehmung des Lebendigen betrachtet Goethe eher als Erfahrung, denn als Erkenntnis. Ja, er sagt sogar über die Idee der Metamorphose: »Sie führt ins Formlose; zerstört das Wissen, löst es auf.«31 Ihre auflösende Tendenz kann nur durch das »zähe Beharrlichkeitsvermögen, dessen, was einmal zur Wirklichkeit gekommen«32 ist, ausgeglichen werden. Einige Jahre nach seiner Italienreise spricht Goethe bei seiner ersten Begegnung mit Schiller über naturwissenschaftliches Erkennen. Bei der Sitzung einer naturforschenden Gesellschaft hatten beide einen Vortrag gehört und Goethe bemerkte dazu: »Einstmals fand ich Schillern daselbst, wir gingen zufällig beide zugleich heraus, ein Gespräch knüpfte sich an, er schien an dem Vorgetragenen teilzunehmen, bemerkte aber verständig und einsichtig und mir sehr willkommen, wie eine so zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, den Laien, der sich gerne darauf einließe, keineswegs anmuten könne.«33 Goethe erwidert, »dass es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Teile strebend darzustellen.«34 Es entwickelt sich ein Gespräch, in dem Goethe Schiller seine Metamorphose der Pflanzen lebhaft vorstellt. Schiller nimmt alles mit großer Teilnahme auf, bemerkt aber zum Schluss ganz entschieden zu Goethes Pflanzenwahrnehmung: »Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee«. Das weckt in Goethe Groll, er beherrscht sich aber und erwidert: «Das kann mir sehr lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.«35 Es entsteht eine heftige Diskussion zwischen dem gebildeten Kantianer Schiller und dem hartnäckigen Realisten Goethe, wie Goethe ihre beiden Persönlichkeiten kennzeichnet. Am Ende ist es der Beginn einer großen Freundschaft. In späteren Jahren kann Goethe den Begriff Idee durchaus als letzte Essenz für seine Erfahrungen des Lebendigen akzeptieren. Während seines Italienaufenthalts spricht er dagegen mehr vom Typus, von der Urpflanze oder vom Urtier. Darunter versteht er eine schaffende Grundgestalt, die sich je nach Pflanzen- oder Tierart modifiziert und variiert: »So entfernt die Gestalt der organischen Geschöpfe voneinander ist, so finden wir doch, dass sie gewisse Eigenschaften miteinander gemein haben, gewisse Teile miteinander verglichen werden können. Recht gebraucht, ist dies der Faden, woran wir uns durch das Labyrinth der Gestalt hindurchhelfen.«36 Bei seiner Suche nach einem Urtier bemerkt er: »Deshalb geschieht hier ein Vorschlag zu einem anatomischen Typus, zu einem allgemeinen Bilde, worin die Gestalten sämtlicher Tiere, der Möglichkeit nach, enthalten wären, und wonach man jedes Tier in einer gewissen Ordnung beschriebe.«37 Einerseits können die bildenden Kräfte des Typus sich in den verschiedenen Organen eines Lebewesens unterschiedlich ausprägen und zu verschiedenen Arten führen, andererseits können auch verschiedene Umweltbedingungen zu unterschiedlichen Ausprägungen einer Art führen. Goethe bemerkt, »dass aber aus der Versatilität dieses Typus, in welchem die Natur, ohne jedoch aus dem Hauptcharakter der Teile herauszugehen, sich mit großer Freiheit bewegen kann, die vielen Geschlechter und Arten der vollkommneren Tiere, die wir kennen, durchgängig abzuleiten sind.«38 Anfangs hofft er noch eine solche ideale Urpflanze tatsächlich auch real finden zu können. Später wird ihm klar, dass der Typus als Urbild aller realen wie denkbaren Pflanzenarten eher einer Idee gleichzusetzen ist: »Schon aus der allgemeinen Idee eines Typus folgt, dass kein einzelnes Tier als ein solcher Vergleichungskanon aufgestellt werden könne; kein Einzelnes kann Muster des Ganzen sein.«39 Goethe und Kant Als Goethe sich in seinem Alterswerk noch einmal mit der Kantschen Philosophie beschäftigt, wird ihm deutlich, wie sehr seine Methodik mit dem Gedankengut Kants übereinstimmt und beide sich gegenseitig ergänzen: »Nun aber kam die Kritik der Urteilskraft mir zuhanden, und dieser bin ich eine höchst frohe Lebensepoche schuldig. Hier sah ich meine disparatesten Beschäftigungen nebeneinander gestellt, Kunst- und Naturerzeugnisse eins behandelt wie das andere; ästhetische und teleologische Urteilskraft erleuchteten sich wechselweise. Wenn auch meine Vorstellungsart nicht eben immer dem Verfasser sich zu fügen möglich werden konnte, wenn ich hie und da etwas zu vermissen schien, so waren doch die großen Hauptgedanken des Werks meinem bisherigen Schaffen, Tun und Denken ganz analog; das innere Leben der Kunst sowie der Natur, ihr beiderseitiges Wirken von innen heraus war im Buche deutlich ausgesprochen.«40 In Anlehnung an Kants Begriff der teleologischen Urteilskraft prägt er nun den genau gewählten Ausdruck »anschauende Urteilskraft«41 für seine Forschungsweise. Er spricht nicht von anschauender Erkenntnis noch von anschauendem Urteil oder von kausaler oder teleologischer Urteilskraft, sondern von anschauender Urteilskraft. Mit dieser Bezeichnung wird deutlich, wie eine Anschauung der äußeren Gestalt in Bezug auf die Gestaltungskräfte, ein Wahrnehmen der nachahmenden gestaltenden Kräfte im eigenen Inneren, zu einer persönlichen Erfahrung, einem individuellen Urteil führt, welches in seiner Entstehung als prozessuale Kraft erfahren wird,. Goethe benutzt den Begriff »anschauende Urteilskraft« nur in einem einzigen Aufsatz und weist hier darauf hin, »dass wir uns, durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewusst und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Typische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern, das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, mutig zu bestehen.«42 Dem Begriff des intuitiven Verstandes, den Kant dieser Betrachtungsart zuschreibt, kann Goethe sich voll anschließen. Kant sah allerdings durch eine solche intuitive Anschauungsweise der Willkür des Menschen Tür und Tor geöffnet, was Goethe süffisant kommentiert: »Deswegen beschränkt unser Meister seinen Denkenden auf eine reflektierende diskursive Urteilskraft, untersagt ihm eine bestimmende ganz und gar.«43 Eine solche sich aus der Logik des Verstandes ergebende Selbstbeschränkung kann Goethe nicht akzeptieren, da sie seiner Erfahrung widerspricht. Goethe Anschauungsweise basiert ja auf Erfahrungen. Er hat sie intensiv geübt und praktiziert und kann daher ein erfahrungsgesättigtes Urteil aussprechen. Kants Überlegungen bleiben dagegen im intellektuell-spekulativen Bereich. Mit der gleichen Erkenntnissicherheit, mit der man die Wahrnehmung der physisch-materielle Welt nicht in Zweifel zieht, kann Goethe von seiner Anschauung des wirkenden Lebendigen als ganz realer Erkenntnisweise sprechen. Ein intuitiver Verstand, eine anschauende Urteilskraft, können für ihn, anders als für Kant, durchaus Instrumente wissenschaftlichen Forschens sein. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie sehr eine wissenschaftliche anschauende Urteilskraft und eine ästhetische Urteilskraft zusammenhängen. Hier zumindest den philosophischen Zusammenhang hergestellt zu haben, rechnet er Kant hoch an: »Es ist ein grenzenloses Verdienst unseres alten Kant um die Welt, und ich darf sagen, auch um mich, dass er in seiner Kritik der Urteilskraft Kunst und Natur nebeneinander stellt und beiden das Recht gibt, aus großen Prinzipien zwecklos zu handeln.«44 Auch Kants Annahme von wirkenden Zweckursachen zur Erklärung organischer Bildungen und Funktionen lehnt Goethe ab. Mit seiner anschauenden Urteilskraft distanziert er sich sowohl von einem naiven Materialismus als auch von einem spekulativen Finalismus: »Nahm die eine Partei die Gegenstände ganz gemein und hielt sich ohne Nachdenken an den bloßen Augenschein, so eilte die andere, sich durch Annahme von Endursachen aus der Verlegenheit zu helfen; und wenn man auf jene Weise niemals zum Begriff eines lebendigen Wesens gelangen konnte, so entfernte man sich auf diesem Wege von ebendem Begriffe, dem man sich zu nähern glaubte.«45 Goethes Wahrnehmung des Lebendigen transzendiert sowohl die Vorstellungen vergangenheitsorientierter Kausalität als auch die zukunftsorientierter Finalität: »Wirkung und Ursache. Koinzidenz bei allen lebendigen Wesen, so dass man ein lebendiges Wesen nennen kann, bei dem Wirkung und Ursache koinzidiert und, weil der Zweck zwischen Ursache und Wirkung fällt, das seinen Zweck in sich selbst hat.«46 Ihm geht es vielmehr um eine beeinflussende Umgebung und um den Typus verändernde Bedingungen in der Gegenwart. »Denn hier wird nicht nach Ursachen gefragt, sondern nach Bedingungen, unter welchen Phänomene erscheinen«47, und in seiner Zoologie heißt es: »Zuerst wäre aber der Typus in der Rücksicht zu betrachten, wie die verschiedenen elementaren Naturkräfte auf ihn wirken und wie er den allgemeinen äußern Gesetzen, bis auf einen gewissen Grad, sich gleichfalls fügen muss.«48 Die Natur aus sich selbst heraus zu verstehen, bedeutet, sie aus der Gegenwart heraus zu verstehen. Goethe bezieht sich dabei auf einen von ihm überarbeiteten Aufsatz zur Natur, in dem es heißt: »Sie setzt alle Augenblicke zum längsten Lauf an, und ist alle Augenblicke am Ziele. […] Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit.«49 Metamorphose Goethe hat kein umfassendes Kompendium zur Botanik oder zur Zoologie verfasst. Seine Forschungen und Schriften konnten nur fragmentarisch bleiben, was wohl auch zur mangelnden Anerkennung seiner naturwissenschaftlichen Leistungen geführt hat. Dennoch ist seine Metamorphosenlehre ein sehr umfassendes Thema, welches vielfach ausführlich behandelt wurde und hier nur angerissen werden kann. Aus seiner künstlerisch-naturwissenschaftlichen Anschauungsweise heraus entwickelt Goethe seine Metamorphoselehre. Dabei benutzt er auch seine zweite beschriebene Gabe, nämlich die des sukzessiven Denkens, also das gedankliche Verbinden der in der Zeit sich ändernden Erscheinungen. Nur so ist das lebendig Gestaltende in zeitlicher Abfolge der sichtbaren Gestaltungen wahrzunehmen. Das Denken muss sehr beweglich und lebendig werden um über das jeweils sich zeigende Geschaffene hinauszugehen und das Schaffende selbst nachzuvollziehen. »Wenn ich eine entstandene Sache vor mir sehe, nach der Entstehung frage und den Gang zurückmesse, soweit ich ihn verfolgen kann, so werde ich eine Reihe Stufen gewahr, die ich zwar nicht nebeneinander sehen kann, sondern mir in der Erinnerung zu einem gewissen idealen Ganzen vergegenwärtigen muss. Erst bin ich geneigt, mir gewisse Stufen zu denken; weil aber die Natur keinen Sprung macht, bin ich zuletzt genötigt, mir die Folge einer ununterbrochenen Tätigkeit als ein Ganzes anzuschauen, indem ich das Einzelne aufhebe, ohne den Eindruck zu zerstören.«50 Wieder zeigt sich, dass Goethes Anschauung über das rein Sinnliche hinausgeht. In die anschauende Urteilskraft und die innere Nachahmung spielen Erinnerung und Erfahrung herein, welche das gerade Wahrgenommene mit früheren Erscheinungen desselben Phänomens oder desselben Lebewesens verbinden. Aus dem heraus ergibt sich die Empfindung, die gedanklich bewusst gemacht werden kann. Veränderungen, Entwicklungen, Verwandlungen werden im Prozess bewusst: »Die Gestalt ist ein Bewegliches, ein Werdendes, ein Vergehendes. Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre. Die Lehre der Metamorphose ist der Schlüssel zu allen Zeichen der Natur.«51Goethes Schriften zur Metamorphose der Pflanzen lassen am leichtesten seine Erkenntnismethodik erkennen, da beispielsweise bei einer blühenden Blume, die verschiedenen Stufen der nacheinander erfolgten Bildungen nebeneinander wahrgenommen werden können: Die nahe am Boden befindlichen, zuerst gebildeten Stängelblätter sind keimhaft, quellend, ungeformt, die später gebildeten werden immer differenzierter und zunächst ausgedehnter, dann gegen die Blüte hin wieder kleiner und feiner. Die Blüte erscheint dann als etwas völlig Neues, ebenso die Staubgefäße und der Fruchtknoten. Trotz der Unterschiedlichkeit dieser Bildungen vom Keimblatt bis zum Fruchtknoten konnte Goethe in allen ein Eines erkennen, nämlich das Prinzip der Blattbildung: »Es war mir nämlich aufgegangen, dass in demjenigen Organ der Pflanze, welches wir als Blatt gewöhnlich anzusprechen pflegen, der wahre Proteus verborgen liege, der sich in allen Gestaltungen verstecken und offenbaren könne. Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt«.52 Goethe haftet also nicht mit gedanklichen Begriffen wie Stängelblätter, Blütenblätter und Staubgefäße an den äußeren Erscheinungen, sondern nimmt sie als manifestierte Ergebnisse einer unter anderem durch Ausdehnung und Zusammenziehung modifizierten Blattbildungstätigkeit wahr. Nicht ein sichtbares einzelnes Blatt dehnt sich aus, differenziert sich oder metamorphosiert sich zu Staubgefäßen, sondern ein kontinuierlich tätiges, unsichtbares Bildungsprinzip der Pflanze, welches durch eigenes inneres Nachschaffen erspürt werden kann.53 Polarität und Steigerung In seinem Alterswerk überdenkt Goethe immer wieder seine Forschungsansätze und -ergebnisse. Dabei wird ihm deutlich, dass seiner Metamorphoselehre in früheren Jahren noch eine Erfüllung fehlte, die ihm im Alter deutlich wird, nämlich »die Anschauung der zwei großen Triebräder aller Natur: der Begriff von Polarität und von Steigerung«.54 Diese Begriffe verwendet er erstmals 1805 in seinem Aufsatz »Polarität«, in dem er beschreibt, wie die Natur aus wenigen Grundmaximen »das Mannigfaltigste hervorzubringen weiß«.55 Zur Erscheinung kommen kann nur das, was eine Spannung in sich entstehen lässt, was sich polarisiert. Dies kann durch Wechsel äußerer Einflüsse hervorgerufen werden: »Man gedenke der leichten Erregbarkeit aller Wesen, wie der mindeste Wechsel einer Bedingung, jeder Hauch gleich in den Körpern Polarität manifestiert, die eigentlich in ihnen allen schlummert.«56 Eine Polarisierung bis hin zur Trennung, hebt eine vorherige Homogenität auf. Es entsteht die »Bereitschaft, sich zu manifestieren, zu differenzieren, zu polarisieren«.57 Nur dadurch kann das Lebensprinzip »die einfachsten Anfänge der Erscheinungen durch Steigerung ins Unendliche und Unähnlichste [...] vermannigfaltigen«.58 Auf diese Weise kann ein »Neues, ein Höheres, ein Unerwartetes«59 hervorgebracht werden. Wirkung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise auf den Menschen Immer wieder weist Goethe darauf hin, wie sehr die Art der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise auf den Menschen und seine gesamte Kulturentwicklung zurückwirkt, was von den meisten Wissenschaftlern überhaupt nicht in Betracht gezogen wird. »Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.«60 Besonders aufgrund dieser Wirkung auf den Menschen beunruhigt ihn die naturwissenschaftliche Entwicklung seiner Zeit, die er für einseitig hält: »Ein Jahrhundert, das sich bloß auf die Analyse verlegt und sich vor der Synthese gleichsam fürchtet, ist nicht auf dem rechten Wege; denn nur beide zusammen, wie Ein- und Ausatmen, machen das Leben der Wissenschaft.«61 Die wissenschaftliche Hauptströmung war auch schon zu seiner Zeit zunehmend von zergliederndem, analytischem Denken geprägt. Die Forderung Descartes‘, nur das Zählbare, durch Messgeräte Erfassbare, könne Objekt wissenschaftlicher Forschung sein, hatte sich schon weitgehend durchgesetzt. Goethe kritisiert die verheerende Wirkung dieser Sichtweise: »Das ist eben das größte Unheil der neueren Physik, dass man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken und beweisen will.«62 Besonders die Umsetzung der mechanistisch gewonnenen Erkenntnisse in Technik und Maschinen beunruhigt ihn sehr: »Das überhandnehmende Maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird kommen und treffen.«63 Ganz anders sieht er dagegen die Wirkung seiner eigenen Betrachtungsweise: »Ohne meine Bemühungen in den Naturwissenschaften hätte ich jedoch die Menschen nie kennengelernt, wie sie sind.«64 Für ihn ist Welterkenntnis und der Austausch mit seinen Mitmenschen die richtige Art und Weise auch über sich selber mehr zu erfahren. Scharf verurteilt er das Bestreben seines Zeitgenossen Heinroth über die Selbstbeobachtung zu einer Selbsterkenntnis des Menschen kommen zu wollen. Hier sieht er eine Verführung »zu einer innern falschen Beschaulichkeit«.65 Innen und Außen hängen für ihn unweigerlich zusammen. Nur in ihrer Polarität zusammengenommen können sie zu einer gesteigerten Erkenntnis führen: »Es ist ein angenehmes Geschäft, die Natur zugleich und sich selbst zu erforschen, weder ihr noch seinem Geiste Gewalt anzutun, sondern beide durch gelinden Wechseleinfluss miteinander ins Gleichgewicht zu setzen.«66 Im Gegensatz zum starren mechanistischen Denken kann ein Wahrnehmen und Erfahren des Lebendigen den Menschen selber beweglich und lebendig machen und erhalten: »Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die organischen, so enden wir, dass nirgends ein Bestehendes, nirgends ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes vorkommt, sondern dass vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke. […] Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschauen der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele, mit dem sie uns vorgeht.«67 Goethe und Aristoteles Bis in die konkrete Betrachtung von Hörnern und Gebiss bei Wiederkäuern lassen sich in Goethes Metamorphoselehre grundlegende Übereinstimmungen zur aristotelischen Naturkunde erkennen. In einem Brief an Schiller bemerkt Goethe, dass er als 18-Jähriger ein Buch Aristoteles‘ gar nicht verstanden, nun aber einen Zugang gefunden habe und es gerne mit Schiller besprechen möchte. Auch den erwähnten Physiognomisten Lavater ermuntert er 1776 zur Lektüre eines Aufsatzes von Aristoteles zur Physiognomie. Immer wieder einmal wird aus seinen Briefen deutlich, dass er sich gerade begeistert mit Aristoteles beschäftigt. An Charlotte von Stein schreibt er 1782: »Mit Mühe habe ich mich vom Aristoteles losgerissen.«68 Zurückschauend auf sein Leben stellt er 1827 fest: »Stünden mir jetzt, in ruhiger Zeit, jugendlichere Kräfte zu Gebot, so würde ich mich dem Griechischen völlig ergeben, trotz allen Schwierigkeiten, die ich kenne; die Natur und Aristoteles würden mein Augenmerk sein.«69 Eckermann berichtet von Goethe, dass dieser in einem Gespräch äußerte: «Aristoteles […] hat die Natur besser gesehen als irgend ein Neuerer.«70 Dies alles zeigt Goethes tiefe Verehrung für Aristoteles und den großen Einfluss, den dieser gerade im Naturwissenschaftlichen auf ihn gehabt hat. Beide sind in vielen Bereichen ganz ähnlich veranlagt, standen als Dichter und Philosophen ganz im praktischen Leben, hatten jugendliche Staatsmänner zu unterweisen (Alexander den Großen, Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach) und entwickelten eine wissenschaftliche Erkenntnistheorie ganz aus ihrer praktischen Forschung heraus. Dabei ist für beide die Intuition als unmittelbares Gewahrwerden der Quell der Erkenntnis oder besser gesagt der Erfahrung. Beide beschränken sich in ihrer Erforschung der belebten Natur nicht auf die physisch-materiellen Aspekte, sondern wenden sich auch den bildenden Lebenskräften zu, wobei sie Zusammenhänge zwischen Wesen und Erscheinung aufzeigen. Wie auch Kant gehen sie von einem formgebenden Prinzip des Lebendigen aus. Goethe bezeichnet dies als Typus, der sich entsprechend den Kräften der Umgebung variiert, Aristoteles als vegetative Seele, die die Bildung organischer Substanz und organischer Gestalt bewirkt. Die Wahrnehmung der bildenden Kräfte ist auch bei beiden sehr ähnlich. Das dabei stattfindende Zusammenwirken und Verbinden von Innen und Außen, von äußerlich wahrgenommenem schaffenden Prozess und innerlich nachvollziehendem Prozess ist für beide eine reale Erfahrung und damit außer Zweifel. Dabei ziehen beide, wie ja auch Kant, die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft, Aristoteles indem er den Unterschied zwischen Stoff- und Formursache im lebendigen Organismus anhand der im Stoff schaffenden Tätigkeit eines Bildhauers erklärt, Goethe indem er seine im Künstlerischen geschulte Sichtweise mit seiner anschauenden Urteilskraft auf das Lebendige anwendet. Allein haben sich einige Begrifflichkeiten in den über 2000 Jahren zwischen Aristoteles und Goethe geändert. So kann Aristoteles noch ganz unbekümmert fordern: »[Es] muss Aufgabe des Naturwissenschaftlers sein über die Seele zu reden und Bescheid zu wissen«. Für ihn war eben das formende Prinzip Kants, der Bildungstrieb Blumenbachs, der Typus Goethes die vegetative Seele. Der Begriff Seele hatte sich aber bis zu Goethes Zeit durch die christliche Prägung verändert. Goethe konnte eine Seele daher nur noch im Zusammenhang mit dem Menschen sehen. Zwar unterscheidet auch Goethe die vier Bereiche der Natur, nämlich »das Unorganische, das Vegetative, das Animale und das Menschliche«71, aber er weist diesen nicht mehr wie Aristoteles verschiedene seelische Ebenen zu. Eine Seele, wie sie zu seiner Zeit verstanden wird, kann Goethe verständlicherweise einem Tier nicht zuordnen: »Ferner verlor man sich, anstatt bei der durch unsere Sinne verbürgten Erfahrung zu bleiben, in leere Spekulationen, wie zum Beispiel über die Seele der Tiere und was dem ähnlich sein mag.«72 Die Beobachtungsgabe Aristoteles‘ schätzt er sehr, kritisiert aber dessen vorschnelle, zu theoretische Urteile: »Es ist über alle Begriffe, was dieser Mann erblickte, sah, schaute, bemerkte, beobachtete, dabei aber freilich im Erklären sich übereilte.«73 Hier spielt wohl auch Goethes grundsätzliche Ablehnung teleologischer Erklärungen herein, die bei ihm teilweise in einem Atemzug mit der Kritik an theologischen Erklärungen zu naturwissenschaftlichen Phänomenen genannt wird: »Ebensoviel und auf gleiche Weise hinderte die fromme Vorstellungsart, da man die Erscheinungen der organischen Welt zur Ehre Gottes unmittelbar deuten und anwenden wollte.«74 Sein Verständnis von Aristoteles‘ Zweckursachen ist vielleicht zu sehr von den christlich geprägten, teleologischen Vorstellungen seiner Zeit beeinflusst. Aristoteles sieht seine Zweck- und Formursache nämlich durchaus nicht nur in einem zukünftigen Ziel begründet, sondern als zur Gegenwart der Natur gehörig. Für ihn ist klar, dass »von Natur zugleich und eines Zweckes wegen die Schwalbe ihr Nest macht«.75 Aus dem gegenwärtigen Wesen, aus der Seele heraus, ergeben sich für ihn natürlicherweise die Gestaltungen und Handlungen der Lebewesen, nicht aus einem zukünftigen Ziel heraus. Diese Sichtweise stimmt eigentlich mit der goetheschen überein. Aristoteles und Goethe impulsieren beide ein wirkliches Verständnis des Lebendigen. Die Polaritäten des vom Geistigen losgelösten Materialismus’ Demokrits und des vom Materiellen losgelösten Idealismus’ Platons steigert Aristoteles zu einem dem Lebendigen angemessenen organischen Denken, welches sich aus einer intuitiven Ebene herleitet. Auch Goethe transzendiert die Vorstellungen mechanistischer und teleologischer Erklärungen des Lebendigen und wendet sich der in der Gegenwart schaffenden und im Zeitenlauf wahrnehmbaren Ebene der wirkenden Kräfte zu. Beide gehen auch analytisch in Einzelheiten, sehen diese aber immer im Zusammenhang mit einem auf einer höheren Ebene liegenden unteilbaren Ganzen. Beide denken organisch. Literatur Anmerkungen |
|